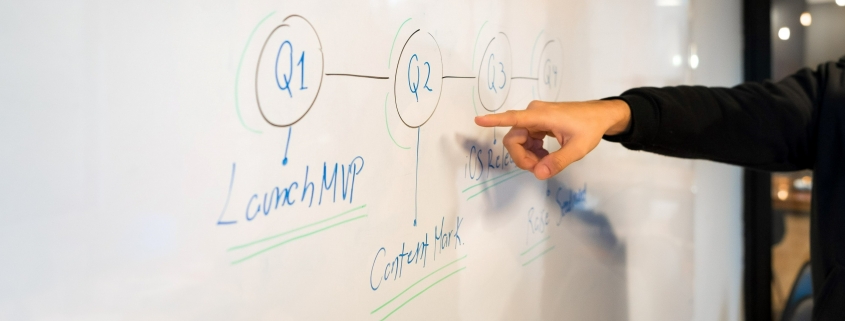Um es gleich vorwegzunehmen – die eine, universell richtige Strategie, auf Amazon zu verkaufen, gibt es nicht. Die Wahl des richtigen Verkaufsmodells ist jedoch ein erfolgskritischer Faktor in jeder ganzheitlich geplanten Distributionsstrategie. Es empfiehlt sich daher eine intensive Auseinandersetzung mit allen zur Verfügung stehenden Optionen.
Rückblick: 1995 startete Amazon-Gründer Jeff Bezos als Online-Buchhändler. Schnell erkannte er, dass er sein Ziel, Amazon zum „größten Online-Kaufhaus der Welt“ zu machen, allein über das Retail-Geschäft mit Amazon-Lieferanten, den sogenannten Vendoren, nur schwer werde erreichen können. So öffnete sich das Unternehmen aus Seattle bereits im Jahr 2002 Jahre für Dritthändler – auch Seller genannt – die seitdem gegen Abgabe einer Verkaufsgebühr in eigenem Namen auf der Plattform verkaufen können.
Wenn auch mit einigen Jahren Verzögerung, setzen mittlerweile immer mehr E-Retailer auf das Marktplatzmodell. Dazu gehören beispielsweise Douglas (2019), Otto (2020), Kaufland (2021, ehemals real.de) oder auch Media-Markt-Saturn, dessen Marketplace sich aktuell noch in einer Beta-Phase befindet. Die Vorteile liegen auf der Hand: Dritthändler über die eigene Plattform verkaufen zu lassen, kommt zum einen den Wünschen der Kunden nach einem möglichst breiten Produktsortiment entgegen. Zum anderen kann damit das eigene – zumindest selektive – Inventar-Risiko reduziert und positive Skaleneffekte für eigene Technologien wie die Amazon Web Services (AWS) realisiert werden.
Amazons Marktplatzgeschäft ist trotz allem Bemühen der Konkurrenz deutlich voraus und hat den eigenen Retail-Handel bereits 2015 an Umsatz übertroffen. Zusätzlich begünstigt durch die Corona-Pandemie haben die Amazon-Seller in Deutschland 2021 mittlerweile doppelt so viel Umsatz erzielen können wie Amazons Eigenhandel und erwirtschafteten damit mehr als ein Drittel (36%) des gesamten, deutschen E-Commerce-Volumens.
Amazon fokussiert sich zunehmend auf das Marktplatzgeschäft
Die Stärkung des für Amazon oftmals profitableren und gleichzeitig risikoärmeren Marktplatzgeschäfts ist dabei sicherlich nicht ungewollt, sondern vielmehr strategisches Kalkül. Begünstigte Amazon in der Vergangenheit seine direkten Lieferanten durch zahlreiche exklusive Programme und Tools, findet seit einigen Jahren eine spürbare Angleichung beider Modelle statt. So sind Formate und Aussteuerungsoptionen im Bereich Advertising mittlerweile nahezu identisch. Unterschiede bei den Gestaltungsmöglichkeiten des eigenen Contents sind marginal – mit Ausnahme des A+ Premium Contents, den nach wie vor nur Vendoren nutzen können. Zudem haben seit 2020 auch Seller Zugriff auf das zuvor exklusiv für Vendoren zugängliche Vine-Rezensionen-Programm. Ebenso stehen beiden Seiten die Amazon-Markenregistrierung sowie daran geknüpfte Markenservices zur Verfügung.
Außerdem wurden Support und persönliche Betreuung für zahlreiche Vendoren durch Vendor- und InStock-Manager deutlich zurückgeschraubt – mit Ausnahme von Amazons größten und stark wachsenden Handelspartnern in jeder Kategorie. Gleichzeitig wurde durch eine Angleichung der zur Verfügung stehenden Brand-Analytics-Daten im Vendor- wie Seller-Central den Vendoren mehr Eigenverantwortung zur Steuerung und Optimierung ihrer Aktivitäten übertragen.
Die Modelle unterscheiden sich weiterhin fundamental
Trotz Angleichungen in vielen Bereichen unterscheiden sich beide Modelle aber nach wie vor stark voneinander und stellen fundamental verschiedene strategische Ansätze dar (B2C vs. B2B). Fällt die Entscheidung für das Vendor-Modell, bedarf es zunächst einer entsprechenden Einladung von Amazon. Ist diese Hürde genommen, sind häufig vertriebspolitische Gründe ausschlaggebend. Zum Beispiel soll damit eine Konkurrenzsituation mit anderen Händlern, die im Zweifel ebenfalls Kunden sind, vermieden werden. Daneben sind auch das zumindest theoretisch höhere Absatzpotential sowie das hohe Vertrauen der Kunden in die Marke Amazon Argumente für den Vendor-Status. Im Gegenzug verlieren Vendoren preispolitische Einflussmöglichkeiten und müssen sich jährlich in zum Teil harte und langwierige Konditionsverhandlungen mit Amazon begeben und weitestgehend auf Endkundenkontakt verzichten.
Seller hingegen schätzen die größere Flexibilität hinsichtlich der Preisgestaltung und die bessere Planbarkeit in Bezug auf Lagerbestand, Margen und Konditionen. Zudem gibt es beispielsweise mit dem Amazon Product Opportunity Explorer oder dem Brand Referral Bonus Programm auch für Seller exklusive Tools, die helfen, Nischen auf dem Marktplatz zu identifizieren oder die Marge über die Incentivierung von Umsätzen, die durch externen Traffic generiert wurden, zu erhöhen.
Als nachteilig werden von Sellern hingegen vor allem der höhere Aufwand bei Fulfillment oder Kundensupport sowie das Risiko einer Account-Sperrung wahrgenommen.
Der hybride Ansatz vereint das Beste aus beiden Welten
Wer über genügend Ressourcen, Know-how und die entsprechende technologische Infrastruktur verfügt, um beide Modelle umzusetzen, für den könnte ein hybrider Ansatz eine lohnende Option darstellen. Dieser vereint die Vorteile von Vendor- bzw. Seller-Dasein. Die höhere Flexibilität bei der Festlegung der Verkaufspreise, die Sicherstellung der Verfügbarkeit auch unrentabler „CRaP-Produkte“ (Can´t Realize any Profit) können für (Teil-) Segmente eines Herstellers oder Händlers ausschlaggebende Argumente für die Wahl eines Hybrid-Modells sein. Richtig gemanaged, kann dieses Modell die erhöhten Aufwände und eventuell auftretende Kannibalisierungseffekte beider Kanäle mehr als aufwiegen.