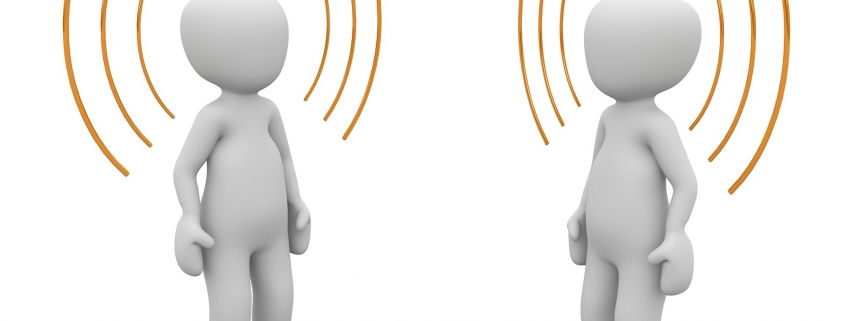Florian Haller: Neu denken, sich selbst immer wieder neu erfinden – gehört „Rethink“ bei einem Tech-Unternehmen wie Facebook zur DNA?
Angelika Gifford: Es ist sogar ein wesentlicher Bestandteil unserer Facebook-DNA, immer Dinge zu hinterfragen, immer neu zu denken. Unsere Leitschnur dabei: Wir bleiben bei allem, was wir tun, unserer Unternehmensmission treu. Nämlich: Wir wollen mit unseren Plattformen Menschen verbinden und ihnen eine Stimme geben. Ein zentraler Treiber beim Neudenken ist für uns die Frage: Was brauchen die Menschen, die unsere Services nutzen, gerade? Wir haben zum Beispiel erst im Sommer Messenger Rooms gestartet, ein einfaches Videokonferenz-Tool im Facebook Messenger, nutzbar für jeden, und haben die Teilnehmerzahl bei Gruppen-Videoanrufen in WhatsApp auf acht erhöht, alles auf Basis des Feedbacks der Menschen da draußen. Rethink heißt für mich auch, dass man sich nie mit dem Stand X eines Produkts zufriedengibt, sondern sich immer fragt: Wie können wir die Dinge verbessern, vereinfachen, beschleunigen, anpassen und weiterentwickeln? Dieses Denken ist bei Facebook sehr ausgeprägt.
Florian Haller: Facebook heute ist nicht mehr Facebook von vor 16 Jahren. Gab es bestimmte Meilensteine der Veränderung im Laufe dieser Zeit, oder ist das eher ein ständiger Prozess?
Angelika Gifford: Es ist ein ständiger Veränderungsprozess, deshalb passieren Anpassungen oft kontinuierlich, graduell über Zeit und mögen dem Betrachter nicht direkt auffallen. Insgesamt haben wir uns aber deutlich weiterentwickelt, zum Beispiel beim Stichwort „Election Integrity“, also allem, was wir unternehmen, um transparente und sichere politische Wahlen sicherzustellen. Eine deutliche Veränderung sehe ich auch beim Thema Kommunikation: Ich glaube, wir sind über die Zeit besser im Erklären geworden, wer wir sind, was wir tun, wie wir denken, wie wir etwas anpacken und wieso. Das ist auch meine persönliche Ambition, „giving a face to Facebook“. Wir müssen nahbarer, erlebbarer sein. Wir machen natürlich auch Fehler und sind noch lange nicht da, wo wir sein wollen. Aber wir sind eine lernende Organisation und entwickeln uns ständig weiter, erfinden uns immer wieder neu.
Florian Haller: Was braucht es, um in Sachen Innovation immer die Nase vorne zu haben?
Angelika Gifford: Ich habe für sehr erfolgreiche Unternehmer arbeiten dürfen, 21 Jahre für Bill Gates und jetzt ein knappes Jahr für Mark Zuckerberg. Und ich erkenne viele Gemeinsamkeiten. Punkt eins: die Vision und die Ausdauer, starke, relevante Produkte auf den Markt zu bringen. Punkt zwei: eine hohe Vielfalt innerhalb des Unternehmens zu schaffen, nicht nur hinsichtlich Geschlecht, sondern auch bezüglich des religiösen, geografischern ethnischen, kulturellen und politischen Hintergrundes und so weiter. Man muss viele Stimmen hören und die Vielfalt der Nutzer und Kunden, die man bedient, intern widerspiegeln. Punkt drei: eine gewisse Rastlosigkeit, bei der man erst mal mithalten können muss. Da härten einen die Amerikaner wirklich ab. Das bedeutet konsequent unternehmerisches Denken, die Bereitschaft, sich zu verändern und eben eine lernende Organisation zu schaffen. Heißt: Es ist erlaubt und sogar erwünscht, auch Fehler zu machen – sofern man daraus lernt und sich weiterentwickelt. Und der vierte Punkt: Mitarbeiter*innen mitnehmen, sie befähigen und ermuntern, sich selbst und das Unternehmen immer wieder zu hinterfragen.
Florian Haller: Wie muss das Empowerment konkret aussehen, damit es bei den in Ihrem Fall mehr als 56.000 Mitarbeiter*innen weltweit auch wirklich ankommt und etwas bewirkt? Was ist Ihr Geheimnis?
Angelika Gifford: Wir versuchen erst mal, unsere Kultur überall im Unternehmen zu materialisieren, auch physisch, sei es auf Postern, Bildschirmschonern, Aufklebern, Unterlagen: Da liest man Dinge wie „Be bold“, „Move fast“ oder auch „What would you do if you were not afraid?“. Man muss die Leute immer wieder inspirieren, ermutigen und daran erinnern: Wir gehören zusammen, das ist unser aller Firma, jede Meinung wird gehört, jeder kann und soll etwas beitragen.
Florian Haller: Poster und Bildschirmschoner, mehr braucht es nicht?
Angelika Gifford: Doch, das waren nur einige konkrete Beispiele. Wir haben insgesamt eine sehr transparente, partizipative Unternehmenskultur und sind eine wirklich durchlässige Organisation. Von offenen Türen sprechen wir gar nicht erst, die Arbeitsflächen in unseren Offices haben oft nicht mal Türen. Außerdem der Grundsatz „Make others look great“, den finde ich wirklich einzigartig: Wenn Sie eine coole Idee haben, fühlen Sie sich befähigt, diese auszuarbeiten, andere ins Boot zu holen, sie dafür zu gewinnen. Und auch den Mut zu haben, damit dann an Führungskräfte heranzutreten, das ist für mich das Wichtigste überhaupt.
Florian Haller: Die Gesellschaft in Deutschland ist – noch – nicht sehr divers. Wie bringen Sie an allen Standorten Diversität in die Organisation?
Angelika Gifford: Erst mal, indem wir überall in Personalgewinnung und -weiterentwicklung großen Wert auf Diversität legen. Jeder unserer Mitarbeiter*innen in Job-Interviews hat vorher Schulungen zum Umgang mit Vorurteilen und viele weitere verpflichtende Trainings durchlaufen. Außerdem können wir als weltweit agierendes Unternehmen, in dem Englisch gesprochen wird, vielen Mitarbeiter*innen anbieten, in ein anderes Land zu wechseln, sei es zum Beispiel nach Deutschland, um hier zwei, drei Jahre lang den Markt und die Kunden kennenzulernen.
Florian Haller: Wie viel Mobilität erwarten Sie von potenziellen Mitarbeiter*innen?
Angelika Gifford: Wir stellen ganz aktuell auch dort Leute ein, wo wir gar kein Office haben, und statten sie dann mit einer Homeoffice-Ausrüstung aus. So gewinnen wir etwa osteuropäische Top-Talente für uns, die nicht unbedingt physisch aus unserem zentralen Office in Warschau arbeiten wollen oder können. Ich denke, das ist ein weiterer Schritt zu noch mehr Diversität bei Facebook, aber auch hin zu neuen, flexibleren Arbeitsmodellen. Wir schätzen, dass in den nächsten fünf bis zehn Jahren jeder zweite Facebook-Mitarbeiter dauerhaft von zu Hause aus arbeiten wird.
Florian Haller: Welche Rolle spielen Unternehmerpersönlichkeiten wie Mark Zuckerberg oder Elon Musk im Kontext von Innovation? Werden sie von der Öffentlichkeit überschätzt?
Angelika Gifford: Diese Unternehmer haben eine starke Vision, eine zündende Geschäftsidee. Mark Zuckerberg zum Beispiel ist ein wirklich außergewöhnlicher Mensch: Er ist 36, ein Visionär, disruptiv, unkonventionell und auch in manchen Dingen provokant. Und er hat eine sehr klare Vision: Menschen weltweit die Möglichkeit zu geben, sich austauschen und Gemeinschaften zu bilden. Das sind mittlerweile mehr als 3,1 Milliarden Menschen. Außerdem hat er bei Facebook eine wirklich offene, vertrauensvolle und Feedback-orientierte Kultur aufgebaut, die jeden befähigt und ermutigt, sich zu hinterfragen und eigenverantwortlich zu handeln. Er teilt seine Ideen, aber auch die Dinge, die nicht gut gelaufen sind. Ich habe noch nie erlebt, dass sich ein CEO jede Woche vor seine gesamte Belegschaft stellt und Fragen beantwortet. Diese sind nicht vorbesprochen, alle können anbringen, was sie bewegt, von der IT-Ausstattung bis zur Unternehmensstrategie, und Mark geht darauf ein und erklärt seinen Standpunkt dazu. Und Unternehmer wie Mark Zuckerberg haben als Mehrheitseigentümer auch den Spielraum, eine langfristige, kohärente Strategie zu verfolgen und in Innovationen zu investieren.
Florian Haller: Facebook hat hauptsächlich junge Mitarbeiter*innen, Sie sind also sozusagen „the adult in the room“. Müsste die Europa-Chefin nicht eigentlich selbst eine 28- oder 30-Jährige sein?
Angelika Gifford: Vielleicht wäre das besser (lacht). Nein, ich glaube es wäre nicht besser. Wir haben sehr viele kreative, agile, schnell denkende, smarte Mitarbeiter*innen. Partizipation und Empowerment von Einzelnen sind essenziell, aber Agilität darf nicht in Chaos münden. Wir wachsen als Firma, da braucht es klare Rahmenbedingungen, Spielregeln, einen Kurs, Prioritäten, um aus diesem an sich sehr guten, kreativen Chaos eine Ordnung und ein Ziel ableiten zu können, was dann jeder mitträgt. Es braucht also aus meiner Sicht eine Symbiose aus strukturierendem Management und Kreativität sowie Agilität.
Florian Haller: Deutschland macht in Sachen Digitalisierung keine gute Figur. Welche Rethink-Hausaufgaben würden Sie dem Land und den Unternehmen mitgeben?
Angelika Gifford: Ich bin über den Digitalisierungsgrad hierzulande seit vielen Jahren enttäuscht. Dass wir so schlecht dastehen, hat auch etwas mit der Mentalität zu tun. Vor dem Neuen hat man in Deutschland oft erst mal Angst, zumindest große Skepsis. Das spüre ich, wenn ich mit Menschen rede, vor allem mit kleinen und mittelständischen Unternehmen. Menschen haben oft Vorbehalte vor Technologie, befürchten, dass künstliche Intelligenz die Welt regieren wird. Diese Angst müssen wir ihnen nehmen. Es muss ein Wandel in der Mentalität her, die Menschen sollten Technologie nicht als Bedrohung, sondern als Chance und Bereicherung sehen. Und ein weiterer Punkt: Schauen Sie sich an, welche bürokratischen Hürden heute beispielsweise zu nehmen sind, wenn man in Deutschland Innovation vorantreiben möchte. Verstehen Sie mich nicht falsch, wir brauchen zum Beispiel ein starkes Datenschutzgesetz! Ich finde aber, wenn laut Bitkom bei jedem zweiten Unternehmen neue, innovative Projekte aufgrund von Datenschutzbedenken scheitern, dann ist das wiederum sehr bedenklich. Und zu guter Letzt das Thema Umsetzung: Oft wird von Digitalisierung groß geredet und es werden bunte, schöne Folien gezeigt, aber die wenigsten investieren richtig, setzen Dinge wirklich um und verändern somit auch ihre Geschäftsmodelle und ihre Kultur. Das alles aber müsste passieren, damit man von erfolgreicher Digitalisierung in einem Unternehmen sprechen kann.
Florian Haller: Wo geht aus Facebook-Sicht in Sachen Technologie die Reise hin? Was ist das Next Big Thing?
Angelika Gifford: Drei Themen beschäftigen uns besonders: Erstens haben wir zum Beispiel unser Facebook Artificial Intelligence Research Lab mit einem internationalen Team, das Grundlagenforschung im Bereich Künstliche Intelligenz betreibt. Ich bin zwar kein Techie, aber was dieses Team da macht, ist absolut führend. Mein zweites Lieblingsthema ist das, was Mark Zuckerberg als großen Trend nach Mobile sieht, nämlich Virtual und Augmented Reality. Wir haben kürzlich erst die neueste Version unserer Oculus-Quest-Brille vorgestellt und haben richtig spannende Anwendungsfälle, nicht nur im Privaten, sondern auch im Business-Umfeld: Ob das virtuelle Schulungen in Warenverteilzentren von DHL sind, virtuelle Operations-Trainings bei Johnson & Johnson oder virtuelle Hotel-Touren für Hilton-Mitarbeiter. Kommendes Jahr werden dann auch Smart Glasses ein großes Thema. Wir arbeiten daran, alle Anwendungen in einer kleinen Brille unterzubringen. Dann können Sie sich etwa eine Wegbeschreibung anzeigen lassen, wenn Sie zum Beispiel München zu Fuß erkunden. Ein drittes Thema ist Nachhaltigkeit. Viele wissen das nicht, aber Facebook ist schon heute der zweitgrößte Abnehmer erneuerbarer Energien weltweit. Darüber hinaus haben wir uns ganz konkrete Klimaneutralitätsziele für 2030 gesetzt: Selbst unsere Zulieferer müssen dann eigene Nachhaltigkeitsziele umgesetzt haben und wir wollen die innovativsten Rechenzentren der Welt am Netz haben. Außerdem haben wir ein Klimainformationszentrum geschaffen, ein Tool auf Facebook, das jeder über sein Menü aufrufen kann und mit dem wir unsere Nutzer mit konkreten Beispielen und Fakten zu einer nachhaltigeren Lebensweise inspirieren möchten.
Florian Haller: Dazu darf ich sagen, Sie sprechen mit dem Chef der ersten zertifizierten klimaneutralen Agenturgruppe Deutschlands nach hundert Tagen. Darauf sind wir richtig stolz. Aber lassen Sie mich bei einem Punkt nachhaken: Bei AR und VR habe ich das Gefühl, dass es in den letzten Monaten ein bisschen still geworden ist. Da fehlt mir der Bezug zum Alltag der Menschen.
Angelika Gifford: Wir arbeiten im Moment genau daran, die Technologie in den Alltag zu bringen – etwa in Brillen, die wir zusammen mit Ray-Ban, einer Marke von EssilorLuxottica, entwickeln wollen. Bis wir ein massentaugliches Produkt haben, das sich jeder morgens aufsetzt, wie er seine normale Brille aufsetzen würde, werden noch Jahre vergehen, sicher. Aber unsere Vision ist es, sinnvolle Produkte für Menschen zu entwickeln, und wir nehmen sie auf dieser Innovationsreise auch mit.
Florian Haller: Wie lautet Ihr wichtigster Rat für die Zukunftsfähigkeit von Unternehmen?
Angelika Gifford: Also, wenn ich die Zauberformel dafür in der Tasche hätte, würden wir uns heute wahrscheinlich nicht unterhalten (lacht). Nun, was müssen wir tun? Wir müssen die Digitalisierung konsequent weiter voranbringen, Innovationstreiber sein. Dafür braucht es die entsprechenden Kompetenzen. Das bedeutet auch, schon unsere Kinder entsprechend auszubilden und ihnen Spaß am Thema IT und Digitales zu vermitteln. Und genau da muss die Politik die richtigen Rahmenbedingungen setzen, sei es bei Bildung und Ausbildung, aber auch bei flexiblen Arbeitsmodellen. Und wir alle müssen erkennen: Technologie ist keine Bedrohung, sondern eine Chance. Die müssen wir nachhaltig nutzen, um in der globalisierten Welt die Nase weiter vorne zu haben.
Florian Haller: Ich danke vielmals für dieses Gespräch.
Dieser Artikel erschien zuerst im TWELVE, dem Magazin der Serviceplan Group für Marken, Medien und Kommunikation. Weitere spannende Artikel, Essays und Interviews von und mit prominenten Gastautor:innen und renommierten Expert:innen lesen Sie in der siebten Ausgabe unter dem Leitthema „Rethink!“. Zum E-Paper geht es hier.