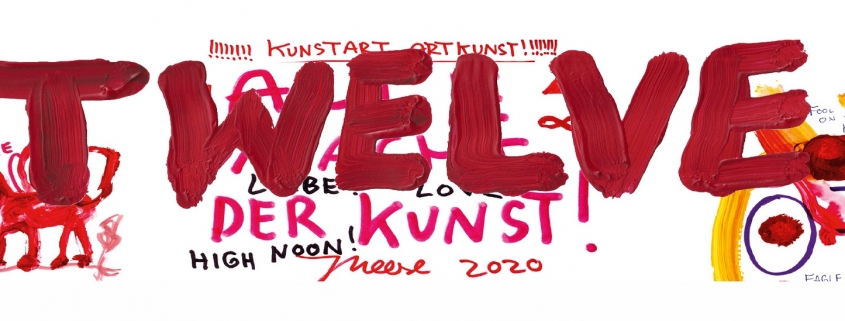COVID-19 hat die Welt verändert – im Großen wie im Kleinen. Das hat Auswirkungen auf die Art, wie wir leben, wie wir miteinander umgehen und natürlich auch, wie wir konsumieren. Dass nach der Krise alles wieder sein wird wie zuvor, daran glaubt Mediaplus-Geschäftsführerin Barbara Evans nicht. Sie zeigt auf, wie sich das Denken und Handeln der Menschen verändert und worauf es jetzt wirklich ankommt: nämlich die Zukunft in die Hand zu nehmen und die Konsumprozesse wesentlich zu vereinfachen.
Das vergangene Jahr wird als ein ganz besonderes in die Geschichtsbücher eingehen. COVID-19 hat unser aller Leben verändert. Verunsicherung hat sich breit gemacht. Menschen sorgen sich um ihre Gesundheit und die ihrer Angehörigen. Sie bangen um ihre Arbeitsplätze und die eigene finanzielle Lage. Wirtschaft, Bildung und Sozialleben wurden auf ein Minimum heruntergefahren. Und auch wenn die Impfkampagne derzeit an Fahrt aufnimmt – die Welt scheint immer noch stillzustehen. Für viele Unternehmen ist die Situation nach wie vor schwierig und wird es auch erst einmal bleiben. Wer nicht mit innovativen Ideen erfolgreich die Flucht nach vorne angetreten hat, dem geht womöglich noch auf den letzten Metern des Lockdowns die Liquidität aus.
Klar ist: Diese Krise ist weitaus fundamentaler und langwieriger als alle anderen Krisen der vergangenen Jahrzehnte. Doch was vielen Unternehmen zugutekam: Wirtschaftskrisen, wie wir sie in der Vergangenheit bereits mehrfach erlebt haben, ähneln sich in Verlauf und Folgen. Es gibt daher erprobte Instrumentarien und Regelwerke, derer sich Wirtschaft und Politik bedienen können. Die Wirtschaft wird sich auch dieses Mal erholen – und ist in vielen Bereichen auch schon auf einem guten Weg. So hat die Bundesregierung ihre Prognose für das Wirtschaftswachstum in diesem Jahr deutlich angehoben. 2021 rechnet sie mit einem Anstieg des Bruttoinlandsprodukts um 3,5 Prozent. Pessimistischer schaut der Sachverständigenrat der Wirtschaftsweisen in die Zukunft: Er hat seine Vorhersage für 2021 zuletzt von 3,7 auf 3,1 Prozent zurückgeschraubt.
Die Lage bleibt also nach wie vor herausfordernd. Was wir weiterhin brauchen, sind kreative und nach vorne gerichtete Ansätze, innovative Herangehensweisen, unkonventionelles Denken und Handeln. Schließlich beobachten wir seit Beginn der Krise ein verändertes Verbraucherverhalten. Dieses zu prognostizieren ist schwierig. Um hier eine verlässliche Aussage treffen zu können, müssen wir lernen, Signale zu lesen und richtig zu deuten, statt uns auf datenbasierte Momentaufnahmen zu konzentrieren. Und wir müssen kurzfristiger und regional kleinräumiger denken und handeln. Die Lage kann sich innerhalb kürzester Zeit erheblich verändern, und dabei können die regionalen Bedürfnislagen extrem unterschiedlich aussehen.
Der Konsum von morgen – eine Vision
Wir haben das Konsumverhalten der Deutschen während der Krise intensiv beobachtet und forscherisch begleitet.[1] Dabei stellten wir fest, dass die Menschen Produkte und Services bevorzugten, die in Funktionalität oder Symbolik ein Gefühl von Geborgenheit hervorriefen. Die Corona-Krise ist aber nur die Spitze des Eisbergs. Die zunehmende Komplexität unserer globalisierten und digitalisierten Welt, die überall spürbaren protektionistischen Tendenzen, die Auswirkungen des Klimawandels, die gesellschaftliche Spaltung – Krisenpotenziale gab und gibt es viele. Etabliertes, Tradiertes und Regionales als Ausdruck eines gesteigerten Sicherheits- und Nähebedürfnisses gewannen deshalb schon vor Corona an Bedeutung für Konsumenten. Durch die Krise aber wurde dieser Trend nochmals deutlich verstärkt.
Auch eine Rückbesinnung auf das Hier und Jetzt lässt sich beobachten – und natürlich auf die Gesundheit. Den Menschen wurde deutlich, wie fragil und volatil das eigene Leben ist, wie schnell sich alles verändern kann, und dass es sinnvoll ist, nicht alles auf morgen zu verschieben. Bei einigen wird das Sicherheitsstreben auch künftig das Konsumverhalten beeinflussen. Für andere wiederum stehen gänzlich andere Bedürfnisse im Vordergrund. Denn Krisenbewältigung ist eine Frage des Lebensstils und der persönlichen Grundhaltung
Was die Menschen hingegen eint, ist ein ausgeprägter Wunsch nach Selbstbestimmung. Die Corona-Krise hat verdeutlicht, wie abhängig wir alle von äußeren Umständen sind. Die Proteste der einen und die Angst der anderen sind vielfach Ausdruck der Sorge um die eigene Autonomie. Für viele von uns ist das eine ganz neue Erfahrung. Wenig überraschend also, dass „Freiheit“ in die Top-3-Werte des Werte-Index[2] der Menschen aufgestiegen ist und damit den „Erfolg“ verdrängt hat.
Zudem zeigen die Konsumenten eine gesteigerte Anspruchshaltung. Sie erwarten nicht nur überzeugende Qualität zum angemessenen Preis, eine gelungene Verzahnung von stationären und digitalen Vertriebswegen und eine zunehmende Verbraucherzentrierung. Vor allem fordern sie – das ist nicht neu, aber deutlich verstärkt – dass Marken gesellschaftliche Verantwortung übernehmen. Verbraucher wünschen sich Transparenz hinsichtlich der Lieferketten und einen gewissenhaften, nachhaltigen Umgang mit Mitarbeitern und Ressourcen. Auch der eigene Anspruch der Menschen an sich selbst ist gestiegen. Sie spüren: Wir müssen etwas tun – für den Klimaschutz, die Freiheit, für Vielfalt und Gleichheit („Black lives matter“). Das ist gut für die Welt, für den Einzelnen und für die Gesellschaft. Vor allem Vielfalt ist die Voraussetzung für Innovation und Entwicklung.
„Das Unerwartete zu erwarten, verrät einen durchaus modernen Geist“
Oscar Wildes Worte sind heute treffender denn je. Nur wer das Unerwartete erwartet und bereit ist, sich mit ihm zu wandeln, der wird langfristig bestehen. Für Markenverantwortliche heißt das: flexibel bleiben, in kürzeren Zyklen denken und planen und die regionalen Unterschiede des Krisenausmaßes berücksichtigen. Auch das Streben nach 100-prozentiger Perfektion passt kaum mehr in diese von rasanten Entwicklungen und ständigen Innovationen geprägten Zeit. Marketers brauchen den Mut, zu testen und sich mit noch nicht Perfektem aus der Komfortzone herauszutrauen. Sie müssen ein Gespür für die Bedürfnisse der Menschen entwickeln, präsent sein, Nähe und Sicherheit vermitteln und – wo sinnvoll – offen sein für Kollaboration. Denn Innovationen entstehen vor allem an Schnittstellen verschiedener Branchen, Märkte und Disziplinen.
Bei allen Herausforderungen bieten Krisen doch immer auch die Chance auf einen Neuanfang, auf große Sprünge und Innovationen. Sie bieten Anstoß, über den Tellerrand zu schauen, Bestehendes zu hinterfragen, zu bewerten, neu zu denken und auszurichten. Also: Schauen wir nach vorne und gestalten aktiv unsere Zukunft. Eine Zukunft, für die wir Konzepte und Technologien brauchen, die das Einkaufen einfacher und angenehmer machen. „Veni, vidi, vici“ wird zu „Kommen, sehen, kaufen“. Wir brauchen eine nahtlose Verknüpfung von Inspiration und Kaufakt und dafür eine gezielte Ausrichtung der Inhalte auf den Handel.
Krisen-Typen:
So reagierten die Menschen auf Corona
Wir haben während der Akutphase sechs Lebensstil-Cluster ermittelt, die die unterschiedlichen Umgangsweisen der Menschen mit der pandemiebedingten Krise sehr deutlich gemacht haben.
- „Catch-up“: Die absoluten Optimisten setzten sich vor allem eines zum Ziel: Versäumtes nachzuholen.
- „Lockdown“: Das Denken und Handeln der Pessimisten wurde weiterhin vor allem von Unsicherheit und Ängsten beeinflusst.
- „Cocooning“: Diese Menschen konzentrierten sich vor allem auf ihr Zuhause und dessen Verschönerung und ließen sich von der Außenwelt vergleichsweise wenig aus der Ruhe bringen.
- „Virtual“: Andere wiederum zeigten sich Neuem gegenüber offen und bewiesen sich als digital-, technologie- und innovationsaffin.
- „Purpose-driven“: Dann gab es die, die Solidarität lebten und sich für Nachhaltigkeit einsetzten.
- „Self-Care“: Und zu guter Letzt solche, die vor allem ihre Gesundheit und das eigene Wohlbefinden in den Vordergrund stellten – mit gewissen egozentrischen Zügen, Konsum- und Prestige-Orientierung.
Clash der Lifestyles: Wer sich zu Hause einigelt, hat kein Verständnis für jene, die sorglos ihrer Feierlaune oder Reiselust frönen – und vice versa. Corona spaltet die Gesellschaft wie selten ein Ereignis zuvor und wird langfristig Spuren hinterlassen, die alle Lebensbereiche nachhaltig prägen werden.
Dieser Artikel erschien zuerst im TWELVE, dem Magazin der Serviceplan Group für Marken, Medien und Kommunikation. Weitere spannende Artikel, Essays und Interviews von und mit prominenten Gastautor:innen und renommierten Expert:innen lesen Sie in der siebten Ausgabe unter dem Leitthema „Rethink!“. Zum E-Paper geht es hier.
[1] Mediaplus Konsumbarometer
[2] Trendbüro, Measury, Bonsai, Kantar: Werte-Index 2020 Corona Update